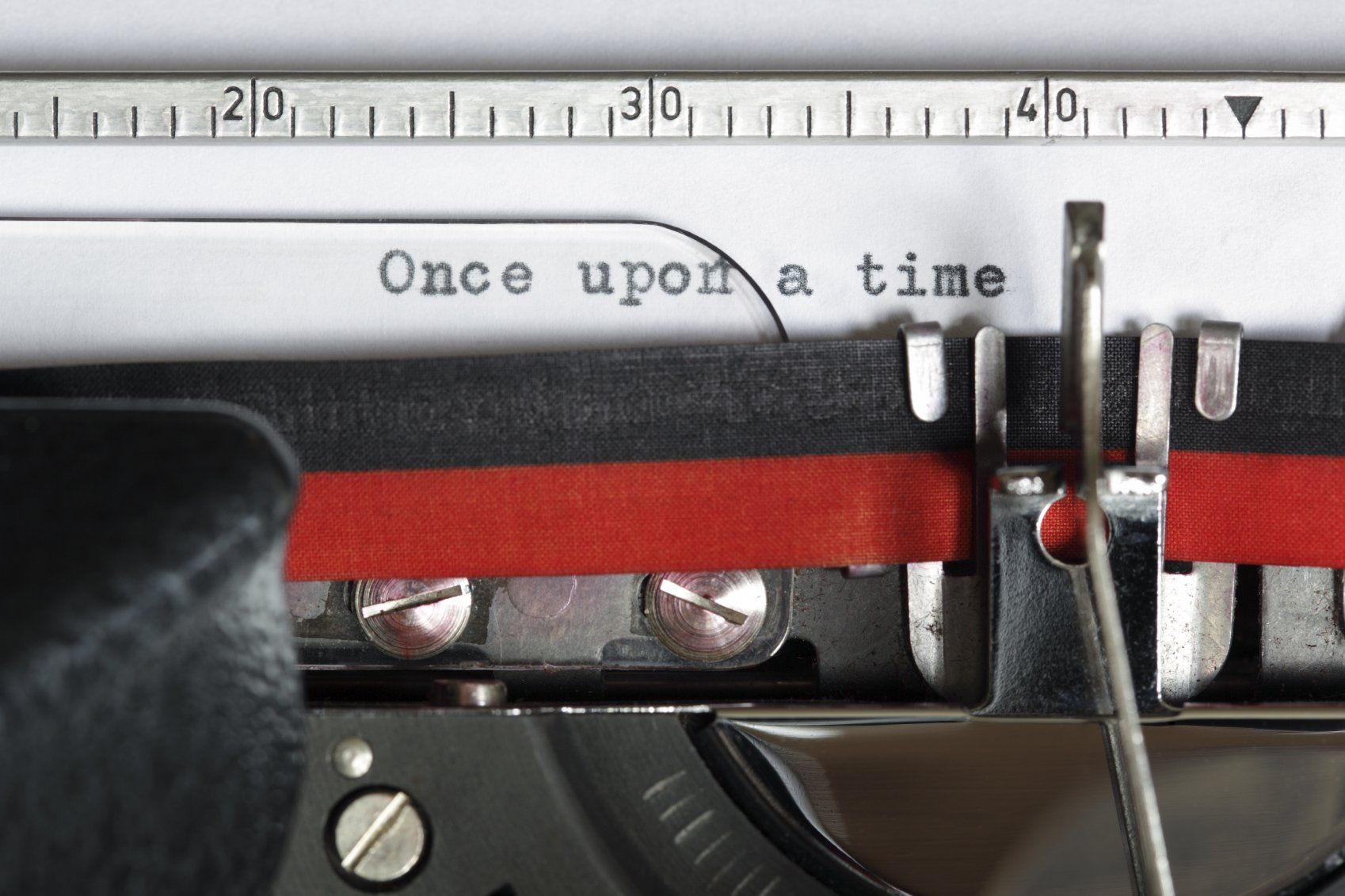Aldous Harding macht ein Fass auf
- von Christopher Büchele
- •
- 13 März, 2019
- •

Vom popkulturellen Hexensabbat
Hexen haben wieder Hochkonjunktur auf den schnell abbrennenden Scheiterhaufen der Popkultur. Letztlich sind sie ja nichts anderes als die weiblichen Gegenstücke zu romantisch verklärten Zauberjünglingen der Marke „Harry Potter“. Nur eben etwas furchterregender – zumindest für das männliche Geschlecht. Weil von ihnen eine Macht ausgeht, die wie eine Verstärkung all dessen wirkt, was Frauen ohnehin an Wirkung auf ihre nur vermeintlich stärkeren Gegenüber haben. Oder haben Sie eine Erklärung dafür, dass an einem Remake von „Charmed“ gebastelt und auch „Sabrina – The Teenage Witch“ wieder aus den verstaubten Aktenschränken der Seriengeschichte geholt wurde, während die „American Horror Story“ gleich eine ganze Staffel dem „Coven“ widmete? Dafür, dass einer der furchterregendsten Horrorfilme der letzten Jahre – „The Witch“ von Robert Eggers – den Blairwitch-Mythos wie ein Kindermärchen wirken ließ oder „Hereditary“ mit derlei Motiven spielte, diesen Sommer fortgesetzt in „Midsommar“, das heidnische Rituale zum Inhalt zu haben scheint? Von Luca Guadagninos Argento-Remake „Suspiria“ und einer imposanten Tilda Swinton in gleich mehreren Rollen (sogar - welch ein Übergriff - als Mann!) ganz zu schweigen?
Kommt es von Ungefähr, dass die Popkultur den fröhlichen Hexensabbat feiert? Oder ist er als Reaktion auf verschwörerische weibliche Umtriebe zu sehen, die nicht weniger als die Umkehrung der Verhältnisse im Kulturbetrieb – kurz: Gleichberechtigung – zum Inhalt haben? Während im Kontext einer unbedingt führenswerten #metoo-Debatte also den Männern zu Recht der Kopf ver- und manchmal sogar der Hals umgedreht wird, reagiert der Film- und Serienbetrieb, in dem sich derlei abspielt, mit der Reaktivierung des Weiblichen in der Zauberei und Fantasterei. Wobei der ganze Vorgang, so schlau sind die Herren der kulturellen Wertschöpfung dann auch nicht, wohl eher unbewusst abläuft. Oder von Frauen umarmt wird, die im Bild der Hexe weibliche Stärke und Traditionen erkennen, mit denen die Männerwelt gemeinhin nur wenig anfangen kann.
Jetzt also auch in der Musik. Denn was die neuseeländische Singer/Songwriterin Aldous Harding mit „The Barrel“ und im zugehörigen Musikvideo zelebriert, ist nichts anderes als ein Hexensabbat. Dazu angetan, uns für immer einzulullen und zu betören mit Beschwörungsformeln, die wohl nur sie selbst versteht und mit Bewegungen, die in ihrer abgehakten Merkwürdigkeit eigentlich nur zum Ziel haben können, den Zuschauer zu hypnotisieren.
It's already dead
I know you have the dove
I'm not getting wet
Looks like a date is set
Show the ferret to the egg
I'm not getting led along.
Wer sich bereits nach einmaligem Hören und Sehen eingehüllt fühlt in diese Welt aus weichen Tüchern, bizarren Plateauschuhen, hohen Hüten und allegorischen Geburtskanälen, der befindet sich in bester Gesellschaft. In tausenden Kommentaren unter dem Video wird auf die tribalistische und fast schamanische Qualität der Darbietung hingewiesen und auch ich muss zugeben, dass ich den Hexenkräften von Aldous Harding vollkommen hilflos ausgeliefert bin – seit Erscheinen der Single aus ihrem kommenden Album „Design“ habe ich das Video mindestens 30 mal gesehen, den zugehörigen Song 50 mal gehört. Wenn’s langt. Das kann einfach nicht mit rechten Dingen zugehen. Und wenn doch, dann nur in Verbindung mit ganz außergewöhnlichen Talenten. Für beides hat man in der Vergangenheit dem starken weiblichen Geschlecht gern den Hexenbesen untergeschoben. Und wir tun das jetzt auch. Allerdings mit einer tiefen Verbeugung und in Anerkennung der Tatsache, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die uns Männern verschlossen bleiben. Einen Hauch davon auf musikalische Art und Weise vermittelt zu bekommen, ist ein echtes Geschenk.

Nicht weniger als die Zukunft des Kinos werde verhandelt, wenn es um die Auseinandersetzung der großen Filmfestivals – und hier insbesondere des Cannes Film Festivals – und Streamingriesen wie Netflix geht. So sieht es zumindest die Financial Times. Weshalb insbesondere das traditionsreiche Festival an der französischen Riviera wie ein bockiges Kind an einer No-Netflix-Politik für seinen Wettbewerb festhält. Die ja auch umgekehrt (von seltenen Ausnahmen abgesehen) zutreffende No-Cinema-Politik des Streamingriesen wird hier gerne als Hauptgrund angeführt, ein Einwand, den jeder verstehen kann, der Alfonso Cuarons „Roma“ lediglich auf dem heimischen Bildschirm zu Gesicht bekommen hat. Dass solche Maßnahmen trotzdem reine Augenwischerei sind, davon zeugt die Tatsache, dass insbesondere Netflix und Amazon als große Player längst nicht mehr von den internationalen Filmmärkten wegzudenken sind. Und die sind am Ende des Tages deren raison d’être, das finanzielle Grundrauschen, ohne welches das glamouröse Drumherum gar nicht denkbar wäre.